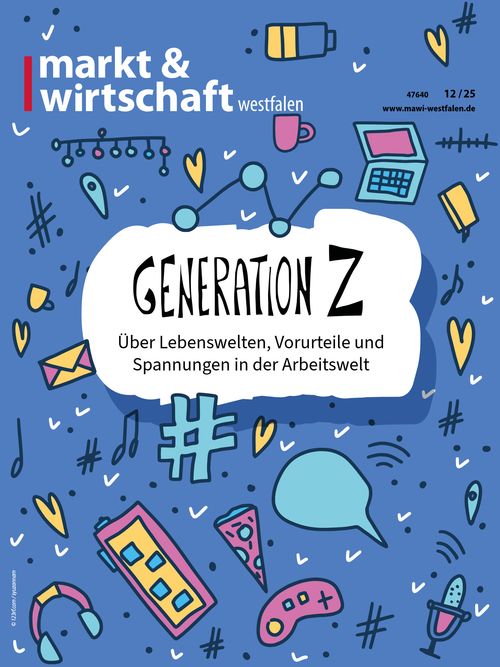Startups werben oft mit flachen Hierarchien, offenen Türen und einer Kultur der Gleichberechtigung. Doch in der Realität zeigt sich häufig ein anderes Bild: Entscheidungswege bleiben intransparent, Gründer behalten die Kontrolle, und informelle Hierarchien entstehen. Doch warum ist das so?
Theoretisch bedeutet eine flache Hierarchie, dass Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und jeder im Team gleichwertig agieren kann. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass Gründer oft die endgültigen Entscheidungen treffen und gewisse Rollen mehr Einfluss haben als andere – auch ohne offizielle Titel.
Selbst in Teams ohne feste Hierarchien entstehen natürliche Machtstrukturen. Einfluss basiert dann nicht auf Titeln, sondern auf Erfahrung, Netzwerken oder Nähe zur Unternehmensleitung. Wer sich gut mit dem Gründer versteht oder wichtige Kundenkontakte hat, genießt oft mehr Entscheidungsfreiheit als andere.
Mit steigender Unternehmensgröße wird es immer schwieriger, Hierarchien flach zu halten. Prozesse müssen definiert, Verantwortlichkeiten geklärt und Strukturen etabliert werden. Häufig münden Startups dadurch in klassische Unternehmensstrukturen – entgegen ihrer ursprünglichen Philosophie.
Flache Hierarchien klingen in der Theorie attraktiv, doch oft bleibt es bei einer schönen Idee. Wer echte Mitbestimmung ermöglichen will, muss bewusst Strukturen schaffen, die allen Beteiligten gleiche Chancen geben – sonst bleibt die Startup-Romantik nur ein Mythos.
Strukturen verändern sich – Start up now! Bis zum nächsten Mal.
Beim nächsten Mal lesen Sie:
Das Rockstar-Problem: Warum Gründer oft schlechte Chefs sind