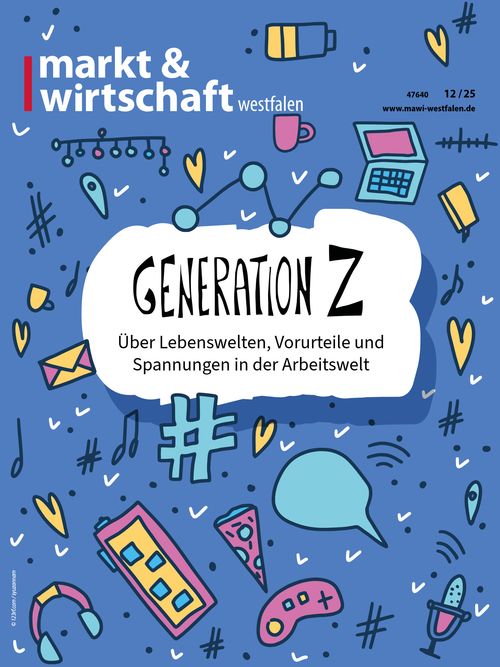Der Klimawandel und die zunehmende Knappheit natürlicher Ressourcen setzen das bisherige Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell unter Druck. Wie Unternehmen sowohl die nachhaltige als auch die digitale Transformation gestalten können und welche Rolle die Führungskräfte in dem Prozess spielen, erklärt Birgit Wintermann, Senior Project Manager bei der Bertelsmann Stiftung
Viele Unternehmen haben sich bereits auf den Weg in eine nachhaltige Zukunft gemacht. Andere sind gerade dabei. Welche Stellschrauben gibt es im Unternehmen, um den ökologischen Fußabdruck, Emissionen und den Ressourcenverbrauch zu senken?
Birgit Wintermann: Es gibt vielfältige Möglichkeiten für Unternehmen, sich ökologisch nachhaltiger aufzustellen. Zunächst muss herausgefunden werden, welche individuellen Stellschrauben man in dem jeweiligen Unternehmen überhaupt hat. Das macht man am besten mit einer Status-quo-Analyse hinsichtlich der Emissionen sowie der verwendeten Ressourcen. Dann sollten die Unternehmen die Nachhaltigkeitsthemen sowohl danach bewerten, wie stark sie selbst die Umwelt und Gesellschaft beeinflussen, als auch danach, wie sehr diese Themen umgekehrt das Unternehmen finanziell betreffen – das ist die sogenannte doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Dazu gibt es bereits vielfache Unterstützungstools.
Aus dieser Analyse ergeben sich dann mögliche Schritte. Dies könnten zum Beispiel sein:
• Einsparung von Emissionen zum Beispiel durch Effizienzprogramme, die Nutzung von erneuerbaren Energien, Flotten- und Prozess-Elektrifizierung (E-Mobilität, Wärmepumpen) und Speichermanagement
• Geringerer Ressourcenverbrauch bei sich selbst, aber auch in Bezug auf die Produkte, zum Beispiel Eco-Design und Lebensdauerverlängerung durch Modularität der Produkte und deren Reparierbarkeit, durch Rental- bzw. Take-Back-Modelle sowie insbesondere durch die Nutzung von Sekundärrohstoffen oder geschlossene Materialkreisläufe
• In der Lieferkette können Dekarbonisierungsprojekte durchgeführt werden.
Dies sind nur einige Beispiele. Wichtig ist: Die Unternehmen müssen ihren ganz eigenen, individuellen Weg finden, sich dem Thema zu nähern – und es strategisch fest für die Zukunft verankern.
Unternehmen, die sich nachhaltiger positionieren möchten, müssen zunächst zum Beispiel in neue Gebäude-, Umwelt- oder digitale Technologien investieren. Das verlangt nicht nur finanziellen Einsatz, sondern auch viel Nachhaltigkeits- und Fachwissen. Wie können insbesondre KMU diese Herausforderungen meistern?
Birgit Wintermann: Die Erkenntnis, dass es sich bei finanziellen Aufwänden um „Investitionen“ handelt und nicht um „Kosten“, ist schon ein sehr wichtiger Schritt. Wenn man verstanden hat, dass es um die Sicherung der Zukunft des Unternehmens geht, ist man im Bewusstsein schon eine Nasenlänge voraus!
Hinsichtlich der Wissensaneignung kann man sich zunächst über Neuerungen in gängigen Branchennewslettern informieren. Dort wird immer über den aktuellen Stand berichtet und das ist ja auch notwendig, um im Wettbewerb informiert zu bleiben. Darüber hinaus sind Wirtschaftsförderungen sehr aktiv – gerade die Pro Wirtschaft GT GmbH des Kreises Gütersloh hat ein umfangreiches und sehr professionelles Portfolio an Informationen, Veranstaltungen, Netzwerken und auch konkreten Beratungen. Darüber hinaus gibt es über die Effizienzagentur NRW das geförderte Circo Programm, in dem Unternehmen lernen können, Circular Economy bei sich umzusetzen. Das WWF bietet einen Selbstcheck und auch Lernformate an. Dies sind nur einige Beispiele. Die Vielfalt und die Angebote nehmen erfreulicherweise täglich zu.
Sie beschäftigen sich seit längerem mit dem Thema doppelte Transformation.
Was steckt hinter diesem Konzept, Nachhaltigkeit und Digitalisierung koordiniert umzusetzen? Wo liegen die Vorteile?
Birgit Wintermann: Dahinter verbirgt sich vor allem die Erkenntnis, dass sowohl die digitale als auch die nachhaltige Transformation für alle Unternehmen und deren Zukunftsfähigkeit unabdingbar – und auch unaufschiebbar – sind. Darüber hinaus kann mit Hilfe der Digitalisierung auch sehr gut das Ziel der Nachhaltigkeit erreicht werden, zum Beispiel bei der Datensammlung für Berichterstattung, bei technologischen Lösungen mit Sensorik, beim Einsatz eines digitalen Produktpasses usw. Also ist es sinnvoll und wichtig, beide Transformationen gleichzeitig und nicht hintereinander voranzutreiben. Wie das genau mit Erfolg funktionieren kann, haben wir uns gemeinsam mit den Kolleginnen vom Fraunhofer IAO Institut in einer Studie angeschaut. Auf diese Weise bleibt man wettbewerbsfähig und fortschrittsorientiert – eine wichtige Voraussetzung für die Zukunft.
Welche Bedeutung kommt den Führungskräften im Transformationsprozess zu und wie wichtig ist es, auch die Mitarbeitenden einzubinden?
Birgit Wintermann: Es ist grundsätzlich wichtig, wirklich alle Menschen eines Betriebes im Prozess einzubinden. Zunächst muss sich allerdings die oberste Ebene zu dem Transformationsthema bekennen und mit Signalen wie der Bereitstellung von finanziellen und personellen Ressourcen auch die Ernsthaftigkeit beweisen. Die Führungskräfte sind jedoch diejenigen, die für die Umsetzung sorgen müssen. Sie sind operativ gefragt und müssen Lösungsansätze moderieren und voranbringen. Sind sie nicht überzeugt und stehen nicht dahinter, wird es sehr schwer, überhaupt eine Umsetzung zu erreichen. Im nächsten Schritt braucht es dann aber natürlich alle Mitarbeitenden: Sie sind die Experten für ihre jeweilige Tätigkeit und können am besten einschätzen, wo Änderungspotenziale sind und diese konkret umsetzen. Von dort kommen meistens die konkreten Ideen und auch der Motivationsschub, an den Themen dranzubleiben. Das Unternehmen muss insofern als eine Einheit agieren.
Inwiefern kann eine Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen oder auch Forschungseinrichtungen bei den Nachhaltigkeitsbemühungen helfen?
Birgit Wintermann: Es gibt zwar schon seit vielen Jahren im Rahmen von CSR Nachhaltigkeitsbemühungen – aber es ist weitgehendst noch als Orchideenthema und zum Abhaken der sozialen Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft behandelt worden. Jetzt geht es um die Existenz des Planeten und der Menschheit – das ist inzwischen unbestritten. Es fehlt das Wissen und die Erfahrung, wie man sehr schnell die notwendigen Veränderungen bewirken kann. Dafür sind Netzwerke, in denen Erfahrungen mit neuen Verfahren und Materialien ausgetauscht werden, in denen Brainstorming erfolgt, Tipps ausgetauscht und auch Neues ersonnen wird, unverzichtbar! Wer jetzt nicht dranbleibt und schnellstens die Umsetzung vorantreibt, wird als Unternehmen spätestens bei der Umsetzung von EU-Regulatorik das Nachsehen haben.
Können sie ein Beispiel aus unserer Region nennen, das zeigt, wie ein Unternehmen bereits nachhaltiges Wirtschaften umsetzt und hierdurch auch Wettbewerbsvorteile generiert?
Birgit Wintermann: Es ist schwierig, hier den Unternehmen im Detail gerecht zu werden – zu schnell ist die Entwicklung. Es lohnt sich ein Hinweis auf die regionalen Netzwerke zu dem Thema. Da möchte ich vor allem Innozent OWL, OWL Maschinenbau und Green OWL als Dachprojekt nennen. Alle Unternehmen, die sich dort engagieren, können sicher als „Frontrunner“ gesehen werden – jeder auch auf unterschiedlichen Gebieten. Das Engagement an sich zeigt aber schon, dass diese Unternehmen an dem Thema arbeiten.
Nachhaltiges Wirtschaften beinhaltet gleich mehrere Impacts. Neben mittel- und langfristig finanziellen Vorteilen kann verantwortungsvolles Handeln weitere positive Auswirkungen haben. Welche Rolle spielt hier eine professionelle Kommunikation?
Birgit Wintermann: Tue Gutes – und rede darüber. Wer soll denn von den Nachhaltigkeitsbemühungen der Unternehmen erfahren, wenn es nicht kommuniziert wird? Dabei geht es sicher um die Frage von Werbung gegenüber Kundeninnen und Kunden. Aber auch die Bedeutung in Recruitingprozessen wird immer wichtiger. Menschen, die sich in der Thematik auskennen, werden schnell auch anhand der Kommunikation herausfiltern können, wer es ernst meint und wer eher ein Feigenblatt hochhält. Den Unterschied macht die Professionalität in der Kommunikation aus. Am Ende hängt es auch davon ab, ob man sogar belangt werden kann, wenn man einen falschen Eindruck hinterlässt – Stichwort Greenwashing. Also sollte man ebenso wie bei der Umsetzung der Maßnahmen auch bei deren Mitteilung sorgfältig und professionell handeln.