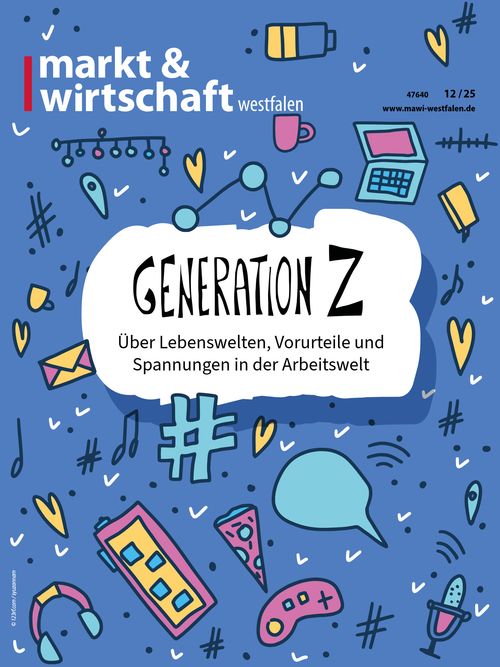Forschende am Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn haben mit einer Reihe von Erfindungen einen wichtigen Impuls für die Weiterentwicklung autonomer Fahrfunktionen gesetzt. Diese Innovationen bieten nicht nur technologische Vorteile, sondern eröffnen auch neue Perspektiven für die sichere, effiziente und kostengünstige Mobilität der Zukunft. Das in 2024 gegründete Startup Xavveo hat sich einige Patente der Hochschule gesichert. Stephan Kruse, Leiter des Forschungsbereichs mm-Wave / THz Elektronik- Photonik Schaltungen und Systeme der Fachgruppe Schaltungstechnik an der Universität Paderborn, und Xavveo-Gründer Dr. Stefan Meister über die Kooperation.
Herr Dr. Meister, beschreiben Sie kurz Ihr Geschäftsmodell.
Dr. Stefan Meister: Wir entwickeln hochauflösende Radarsensoren, die Fahrzeugen ein autonomes Fahren ermöglichen. Das Auto bekommt einen 360-Grad-Blick auf seine Umgebung und ist so in der Lage, Echtzeitentscheidungen zu treffen und Unfälle zu verhindern.
Welche Technologie steckt dahinter?
Dr. Stefan Meister: Unser Know-how liegt in der Entwicklung von Chip-Design. Die Besonderheit besteht darin, dass sich Elektronik und Photonik auf einem Chip befinden. Wir sprechen hier von Silizium-Photonik. Damit erreichen wir den momentan höchsten Integrationsgrad.
Radarsysteme gibt es bereits viele auf dem Markt. Was ist das Besondere Ihrer Technologie?
Dr. Stefan Meister: Radarsysteme werden in der Regel für Abstandsmessungen eingesetzt. Gute Bilder von der Umgebung erzeugen diese allerdings nicht, weil die Auflösung viel zu gering ist. Alternativen wie Kamera, Laserscanner oder Radarboxen, die mit Antennen von zehn Zentimeter mal zwölf Zentimeter Größe ausgestattet sind und normalerweise in die Stoßstange platziert werden, sind allerdings auch nicht optimal. Deshalb haben wir eine Technologie entwickelt, bei der sehr viele Sensoren über das ganze Fahrzeug verteilt und allesamt zusammengeschaltet sind. Diese optisch verteilten Radarsysteme sind in der Lage, zuverlässig hochwertige Bilder auch bei schlechtem Wetter wie Regen, Schnee und Nebel zu erzeugen, und ermöglichen nicht nur reibungslosere, sondern auch sichere Fahrerlebnisse.
Herr Kruse, die Fachgruppe Schaltungstechnik hat in den letzten fünf Jahren mehr als 15 wegweisende Erfindungen für Anwendungen in Kommunikationstechnologien oder Radartechnik an die Industrie verkauft. Welche Branchen profitieren von Ihren Forschungstätigkeiten und wo liegt der wirtschaftliche Nutzen?
Stephan Kruse: Im Prinzip profitieren alle Unternehmen, die sich mit der Entwicklung und Verbesserung von aktuellen Radar- oder auch Kommunikationssystemen beschäftigen. Das Startup Xaveeo beispielsweise nutzt einige unserer Patente als Option, um optisch unterstützte Radarsysteme in der Leistungsfähigkeit effizienter zu machen. Jeder, der ein Auto mit Elektroantrieb fährt, weiß, dass die Akkus der Motoren schnell leer sind. Bei autonom fahrenden E-Autos mit Sensorsystem erhöht sich der Akkuverbrauch erheblich, sodass das Fahrzeug mehr steht als fährt. Hier können unsere Patente helfen, wie zum Beispiel ein photonisch unterstütztes Sensorsystem, das einen entscheidenden Fortschritt für die Sensorik in Fahrzeugen darstellt, insbesondere für Anwendungen, bei denen Gewicht und Platz eine Rolle spielen.
Unsere Technologie ist in der Lage, die Verlustleistung zu reduzieren und die Komplexität der Systeme ausfallsicherer zu gestalten. Dies führt unter anderem zu mehr Reichweite. Der Durchsatz wird erhöht und die Fehlerrate minimiert. Und letztendlich reduzieren sich auch die Kosten.
Eine weitere Erfindung ermöglicht eine genaue Zieldetektion und präzise Vermessung im Nahbereich. Konventionelle Radarsysteme geraten häufig aufgrund von Störsignalen und physischen Begrenzungen an ihre Grenzen. Für Anwendungen wie Einparkhilfen oder Rangierunterstützung, die mithilfe von Ultraschalltechnologie funktionieren, ist das kein Problem. In Gefahrensituationen allerdings, in denen schnell Informationen benötigt werden, reicht diese Technologie nicht aus. Da braucht es spezielle Lösungen, die störende Einflüsse minimieren und gleichzeitig eine verbesserte Winkelauflösung bieten. Mithilfe der Integrierung der Optik in Radarsysteme sind wir einen großen Schritt vorangekommen.
Zuletzt haben Sie neue Maßstäbe im Bereich der elektrooptischen Schaltungen und Systemen gesetzt und Technologien entwickelt, die das Potenzial haben, die Telekommunikations- und Radartechnik zu verbessern. Um welche Technologien handelt es sich und welche Vorteile bieten sie?
Stephan Kruse: Hier möchte ich mit einem Beispiel aus der Radartechnik antworten. Bei den sogenannten verteilten Radarsensoren werden mehrere Antennen zu einer phasengesteuerten Gruppenantenne zusammengeschaltet. Die Winkelgröße hängt sehr stark von der Größe des Antennenarrays ab. Das bedeutet, in der kabelgebundenen Elektronik sind die Übertragungsverluste wesentlich größer als bei der Elektrooptik. Während hier die Verluste mit nur etwa zwei bis drei Prozent pro Kilometer zu Buche schlagen, liegen sie bei der herkömmlichen kabelgebundenen Technologie bei etwa 25 Prozent pro zehn Zentimeter.
Wir können dank dieser neuen Möglichkeiten beliebig große Antennensysteme bauen und erhalten so Winkelauflösungen, die gleichwertig oder sogar besser sind als die heute existierenden LiDAR-Systeme. Solche LiDAR-Systeme nutzen Laserstrahlen, um in Echtzeit Entfernungen präzise zu messen.
Diese Erfindungen haben Sie mit Unterstützung der Patentverwertungsagentur der nordrhein-westfälischen Hochschulen PROvendis an das Unternehmen Xavveo verkauft. Haben Sie im Auftrag des Unternehmens die Technologie entwickelt aufgrund einer vorgegebenen Problemstellung?
Stephan Kruse: Wir beschäftigen uns schon einige Jahre mit elektrooptischen Schaltungen und Systemen und haben bereits vor der Kooperation mit Xavveo mit einem anderen Unternehmen zusammengearbeitet. Als das Projekt abgeschlossen war, haben wir uns mit der Thematik weiter beschäftigt und Patente angemeldet. Die Gründer von Xaveeo waren an unseren Forschungsarbeiten zur Radartechnik interessiert und haben sich Optionen darauf gesichert, die nach drei Jahren automatisch als Patente in deren Eigentum übergehen.
Neben zwei elektrooptischen Mischern handelt es sich um eine elektrooptische PLL-Schaltung und einen optoelektronischen Oszillator für Radarsysteme sowie einen elektrooptischen Balun für eine besonders saubere Signaldetektierung in anspruchsvollen Kommunikations- und Sensoranwendungen.
Herr Dr. Meister, Sie haben Patente von der Universität Paderborn erworben. Was bedeutet der Erwerb dieser neuen Technologien für Ihr Unternehmen?
Dr. Stefan Meister: Der Erwerb der Patente war für uns sehr wichtig, um unsere Technologie gegenüber Marktbegleitern zu schützen. Noch arbeiten wir an der Weiterentwicklung der Technologie und setzen alles daran, diese erfolgreich auf den Markt zu bringen. Außerdem haben wir im letzten Jahr eine Finanzierungsrunde absolviert. Es ist wesentlich überzeugender gegenüber Investoren, wenn wir im Besitz von Patenten sind. Die von der Universität Paderborn gekauften Patente waren erst ein Anfang. Darauf aufbauend werden wir unser Portfolio an Schutzrechten weiter erhöhen.
Wie beurteilen Sie das Forschen und Entwickeln mit einem Partner aus der Wirtschaft? Wo sehen Sie Vorteile oder auch Nachteile?
Stephan Kruse: Die Kooperation mit einem Partner aus der Wirtschaft sehe ich ein wenig zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es schön zu sehen, dass unsere Forschung nicht im Elfenbeinturm verbleibt, sondern tatsächlich zur Nutzung gelangt und das jeweilige Unternehmen in seinem Business Case voranbringt.
Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass die Direktbeauftragung durch ein Unternehmen finanzielle Abhängigkeiten schafft und mit Blick auf die Planung Unsicherheiten mit sich bringt. Bei öffentlich geförderten Projekten ist das wesentlich entspannter. Generell überwiegt jedoch die Freude, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten.
Wo liegt für Sie der Mehrwert auf wissenschaftliche Expertise zuzugreifen?
Dr. Stefan Meister: Unternehmen, die in einem hochtechnologischen Umfeld arbeiten, die auf die Entwicklung von Innovationen angewiesen sind, diese zudem schnell umsetzen und den Stand der Technik berücksichtigen müssen, können von einer Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern profitieren. In solchen Kooperationen hat man die Chance, zu experimentieren, und das auf einem Niveau, das auch finanzierbar ist. Sinnvoll ist es, gemeinsam Forschungsprojekte zu beantragen. Dennoch muss man auch sagen, dass so eine Zusammenarbeit nicht immer einfach ist. Hochschulen sind da um einiges unkomplizierter als Institute, die viel mehr Regularien haben.
Herr Kruse, wie beurteilen Sie im Rückblick die Zusammenarbeit mit Xavveo?
Stephan Kruse: Das sehe ich durchweg positiv. Zumal wir uns schon seit einigen Jahren kennen und bereits vor der Gründung des Startups in anderen Konstellationen zusammengearbeitet haben.
Es gibt auch schon ein gemeinsames Nachfolgeprojekt unter dem Namen LiRaS, das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert wird. LiRaS vereint Kernkomponenten der Radar- und der auf Laser beruhenden LiDAR-Technologie auf einem Chip, um eine umfassende und ausfallsichere Erfassung des Fahrzeugumfelds zu gewährleisten. Durch die Kombination werden die Vorteile beider Technologien in einem gemeinsamen Sensor vereint und die technologiebedingten Einschränkungen des Einzelsensors ausgeglichen.

Das Interview ist Teil unserer Serie, in der wir in Kooperation mit der PROvendis GmbH über die erfolgreiche Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft berichten.